Quelle
Preisend mit viel schönen Reden 12. März 1917, Fritz Gille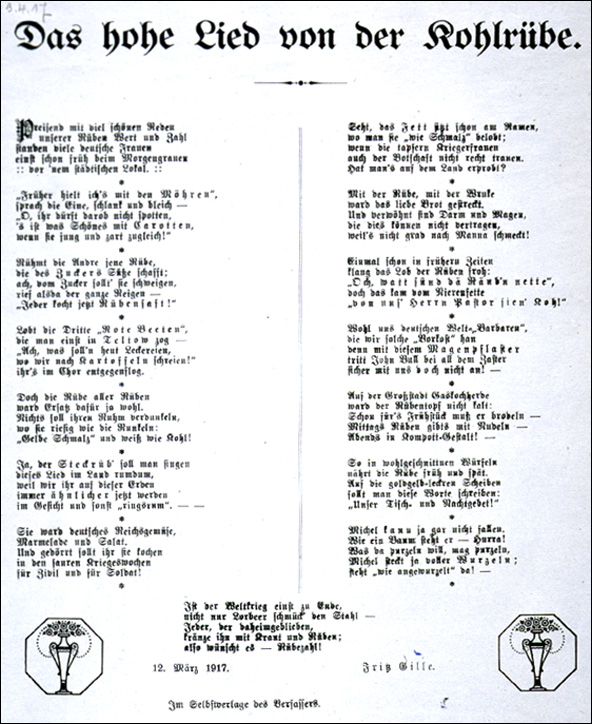
unserer Rüben Wert und
Zahl
standen viele deutsche Frauen
einst schon früh beim
Morgengrauen
vor ‘nem städtischen Lokal.
„Früher hielt ich’s
mit den Möhren”,
sprach die eine, schlank und bleich –
„O, ihr
dürft darob nicht spotten ,
‘s ist was Schönes mit
Karotten,
wenn sie jung und zart zugleich!”
Rühmt die Andre
jene Rübe,
die des Zuckers Süße schafft;
ach vom Zucker sollt’
sie schweigen,
rief als da der ganze Reigen –
„Jeder kocht
jetzt Rübensaft!”
Lobt die dritte „Rote Beeten”,
die man einst
in Teltow zog –
“Ach, was soll’n heut Leckereien,
wo wir nach
Kartoffeln schreien!”
ihr’s im Chor entgegenflog.
Doch die
Rübe aller Rüben
ward Ersatz dafür ja wohl.
Nichts soll ihren
Ruhm verdunkeln,
wo sie riesig wie die Runkeln:
„Gelbe
Schmalz” und weiß wie Kohl!
Ja, der Steckrüb’ soll man
singen
dieses Lied im Land rumdum;
weil wir ihr auf dieser
Erden
immer ähnlicher jetzt werden
im Gesicht und sonst
„ringsrum”. – –
Sie ward deutsches Reichsgemüse,
Marmelade und
Salat.
Und gedörrt sollt ihr sie kochen
in den sauren
Kriegeswochen
für Zivil und für Soldat!
2
Seht, das Fett
ist schon am Namen,
wo man sie „wie Schmalz” belobt;
wenn die
tapfern Kriegerfrauen
auch der Botschaft nicht recht
trauen
Hat man’s auf dem Land erprobt?
Mit der Rübe, mit der
Wruke
ward das liebe Brot gesteckt.
Und verwöhnt sind Darm und
Magen,
die dies können nicht vertragen,
weil’s nicht grad nach
Manna schmeckt!
Einmal schon in früheren Zeiten,
klang das Lob
der Rüben froh:
„Och, watt fünd dä Händ’n nette”,
doch das kam
vom Nierenfette
„von auf’ Herrn Pastor sien’ Kohl!”
Wohl und
deutschen Welt–„Barbaren”,
die wir solche „Vorkost” han’
denn
mit diesem Magenpflaster
tritt John Bull bei all dem
Zaster
sicher mit uns doch nicht an!
Auf der Großstadt
Gaskochherde
ward der Rübentopf nicht kalt:
Schon für’s
Frühstück muß er brodeln –
Mittags Rüben gibts mit Nudeln
–
Abends in Kompott-Gestalt! –
So in wohlgeschnittnen
Würfeln
nährt die Rübe früh und spät.
Auf die goldgelb-leckren
Scheiben
sollt man diese Worte schreiben:
“Unser Tisch- und
Nachtgebet!”
Michel kann ja gar nicht fallen
Wie ein Baum
steht er – Hurrah!
Was da purzeln will, mag purzeln,
Michel
steckt ja voller Wurzeln
steht „wie angewurzelt” da!
Ist der
Weltkrieg einst zu Ende,
nicht nur Lorbeer schmückt den Stahl
–
Jeder, der daheimgeblieben,
kränze ihn mit Kraut und
Rüben,
also wünscht es – Rübezahl!
Quelle: Deutsches Historisches Museum